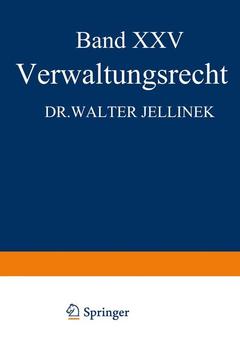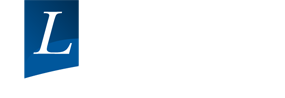§ 1. Verwaltung.- I. Verwaltung, Regierung, Rechtsprechung.- II. Verwaltung, Gesetzgebung, Justiz.- 1. Die Lehre MONTESQUIEUS von der Trennung der Gewalten.- 2. Die Trennung der Gewalten im geltenden Rechte.- a) in der Gesetzgebung.- b) in der Justiz.- c) in der Verwaltung.- III. Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.- 1. Fernsein von Befehlsbefugnissen.- 2. Gegenseitige Unaufhebbarkeit der Justiz- und Verwaltungsakte.- 3. Gegenseitige Anerkennung der von der andern Gewalt erlassenen Akte.- § 2. Fortsetzung, öffentliche und fiskalische, freie und gebundene Verwaltung.- I. öffentliche und fiskalische Verwaltung.- 1. öffentliche Verwaltung.- a) Obrigkeitliche Verwaltung.- b) Schlichte Hoheitsverwaltung.- 2. Fiskalische Verwaltung.- II. Freie und gebundene Verwaltung.- 1. Der Unterschied und seine Bedeutung.- 2. Das freie Ermessen.- 3. Die Ermessensfehler.- 4. Freiheit und Gebundenheit in Justiz und Verwaltung.- §3. Verwaltungsrecht.- I. Allgemeine Umgrenzung.- II. Verwaltungsrecht und Staatsrecht.- III. Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Jugendrecht.- IV. öffentliches Recht und Privatrecht.- 1. Bedeutung der Unterscheidung.- 2. Grenze zwischen öffent-lichem Recht und Privatrecht.- 3. öffentlichrechtliche und privatrecht¬liche Vorfragen.- 4. Zulässigkeit des Rechtsweges und Kompetenzkonflikt.- §4. Überblick über die Verwaltungsorganisation.- I. Grundsätzliches.- II. Reichsbehörden.- III. Landesbehörden der inneren Verwaltung.- 1. Preußen.- 2. Bayern.- 3. Sachsen.- 4. Württemberg.- 5. Baden.- 6. Thüringen.- 7. Hessen.- 8. Mecklenburg- Schwerin.- 9. Oldenburg.- 10. Braunschweig.- 11. Anhalt.- 12. Lippe.- 13. Mecklenburg-Strelitz.- 14. Schaumburg- Lippe.- 15. Hamburg, Bremen, Lübeck.- IV. Verfassung der Gemeinden und höheren Kommunalverbände.- 1. Die Gemeinden.- a) Gesetzliche Grundlagen.- b) Benennungen.- c) Willensbildung in den Gemeinden (insbesondere Magistrats-, Bürgermeister-, Einkollegien-, Zweikollegienverfassung).- d) Gemeindeverbindungen (insbesondere Zweckverbände, Samtgemeinden, Eingemeindung).- 2. Die höheren Kommunalverbände, länderweise dargestellt.- §5. Geschichte des Verwaltungsrechts.- I. Der ältere Justizstaat.- II. Der Polizeistaat.- III. Der heutige Rechtsstaat.- 1. Verfassungsstaat.- 2. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.- 3. Genau umschriebene Ermächtigungen.- 4. Vorherrschen der gebundenen Verwaltung.- 5. Förmliche Verwaltungsakte.- 6. Der neuere Justizstaat.- 7. Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit.- Zusammenfassung der im Rechtsstaatsgedanken liegenden Ideale.- IV. Ausblicke (Generalklausel, Kodifikationen).- §6. Die Verwaltungsrechtswissenschaft. — Schrifttum.- I. Gliederung der Verwaltungswissenschaft.- II. Verwaltungslehre und Verwaltungspolitik.- III. Verwaltungsrechtswissenschaft.- 1. Werke zur Vermittlung von Gesetzeskunde.- 2. Werke zur juristischen Durchdringung des Verwaltungsrechts.- a) OTTO MAYER.- b) OTTO MAYERS Vorgänger und die von ihm beeinflußten Lehrbücher.- c) Einzelschriften.- d) Kommentare und Handbücher für Sondergebiete.- e) Übungsfälle und Aktenstücke.- f) Zeitschriften.- 3. Sammlungen von Entscheidungen.- 4. Ausländisches Verwaltungsrecht.- 5. Rechtsvergleichung und internationales Recht.- IV. Gliederung der folgenden Darstellung.- Allgemeiner Teil.- §7. Die Quellen des Verwaltungsrechts.- I. Einleitung.- II. Reichsrecht und Landesrecht.- III. Ursprüngliche Rechtsquellen.- 1. Das Gesetz.- a) Arten der Gesetze.- b) Eigenschaften des Gesetzes (Gesetzeskraft, Erforderlichkeit).- 2. Das ursprüngliche Gewohnheitsrecht.- 3. Tatsachen mit ursprünglicher Rechtssatzwirkung.- IV. Abgeleitete Rechtsquellen.- 1. Rechtsverordnungen, insbesondere Polizeiverordnungen.- 2. Autonome Satzungen.- 3. Sonstige Quellen mit abgeleiteter Rechtssatzwirkung.- V. Sammlungen der geschriebenen Rechtsquellen.- 1. Amtliche Gesetz- und Verordnungssammlungen.- 2. Private Sammlungen.- VI. Zeitliche und räumliche Herrschaft der Verwaltungsrechtssätze.- 1. Zeitliche Herrschaft 141–144 (Außerkrafttreten 141, Zulässigkeit der Rückwirkung 142, Gewolltsein der Rückwirkung 143).- 2. Räumliche Herrschaft 144–149 (Gebietsänderungen 144, räumliche Schranken der Rechtssetzungsgewalt 146, Sitz der verwaltungsrechtlichen Rechtsverhältnisse 147, freiwillige Selbstbeschränkung des Gesetzgebers in räumlicher Hinsicht 148).- VII. Gesetzesanwendung 149–155 Einhelligkeit als oberstes Ziel 149, Schluß vom Zweck aufs Mittel 150, Analogie, insbesondere analoge Heranziehung des bürgerlichen Rechts 151, Lücken im Verwaltungsrecht.- §8. Die Subjekte des Verwaltungsrechts.- I. Der Mensch.- 1. Geburt, Ehe und Tod 158–162 (insbesondere Beurkundung des Personenstandes 158, Feuerbestattung 161, Leichenablieferung 161).- 2. Der Name.- 3. Gleichheit und Ungleichheit der Menschen im Ver¬hältnis zum Staate.- a) Gleichheit vor dem Gesetze.- b) Verschiedenheit des Geschlechts.- c) Verschiedenheit des Alters und der sonstigen geistigen Reife.- d) Ehrennachteile (Ehrverlust durch gerichtliches Urteil) und Ehrenvorzüge (Titel, Orden und Ehrenzeichen).- e) Inländer und Ausländer.- II. Die juristischen Personen.- 1. Begriff und Arten 172–176 (insbesondere Körperschaften, Stif-tungen und Anstalten 173, Unterscheidungsmerkmale der juristischen Person des öffentlichen Rechts gegenüber der des Privatrechts 174).- 2. Die juristischen Personen des Privatrechts im Verwaltungsrecht.- 3. Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts.- a) Stiftungen des öffentlichen Rechts.- b) rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts 178–180 (insbesondere Versicherungsanstalten 178, Reichsbank und Reichs-bahngesellschaft 179).- c) Körperschaften des öffentlichen Rechts 180–187 (insbesondere Innungen 180, Handwerkskammern 181, Industrie: und Handelskammern 182, Landwirtschafts- und Bauernkammern 183, Ärzte-kammern 184, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften 184, Wasser-genossenschaften und Deichverbände 185, Fischereigenossenschaften 186, Ge-bietskörperschaften 186).- d) Rechtsstellung der juristischen Personen öffent-lichen Rechts außerhalb des Landes.- 4. Der Staat als Untertan.- §9. Die Rechtsverhältnisse in der Verwaltung, öffentliche Pflichten und Rechte.- I. Rechtsverhältnis und Rechtszustand.- II. Öffentliche Pflichten.- 1. Arten.- 2. Nachfolge in öffentliche Pflichten und Stellvertretung 194–200 (insbesondere Gesamtrechtsnachfolge 195, Dinglichkeit 195, Baulastenbücher 197, Anliegerbeiträge 198, Pflichtübernahme 199).- III. öffentliche Freiheit.- IV. Die subjektiven öffentlichen Rechte.- 1. Wesen und Vorkommen 201–203 (insbesondere Recht des Baunachbarn 202).- 2. Träger der subjektiven öffentlichen Rechte.- 3. Stufen der öffentlichen Rechte des einzelnen.- 4. Arten der öffentlichen Rechte des einzelnen.- a) Mitwirkungsrechte.- b) positive Ansprüche.- c) Freiheitsrechte (Rechte auf Unterlassung).- d) Anhang: die wohlerworbenen Rechte der Beamten.- 5. Subjektives Recht und freies Ermessen.- 6. Nachfolge in öffentliche Rechte und Stellvertretung 211–214 (insbesondere Gesamtrechtsnachfolge 212, Ding¬lichkeit 212, rechtsgeschäftliche Übertragung 213, Stellvertretung 214).- 7. Verzicht auf öffentliche Rechte.- § 10. Die rechtserheblichen Tatsachen.- I. Die Zeit.- 1. Zeitbestimmung und Zeitberechnung.- 2. Die Tages- und Jahreszeiten.- 3. Sonn- und Feiertage.- 4. Rechtsbegründende und rechtsvernichtende Fristen.- II. Der Raum und auf den Raum zurückgeführte Einheiten.- 1. Raumbestimmung und Raummessung.- 2. Auf den Raum zurückgeführte Einheiten.- 3. Das Geld als Preisanzeiger insbesondere.- a) Münzgesetz.- b) Bankgesetz.- c) Aufwertungsfragen.- III. Die Zahlen.- Unbestimmte Zahlwörter.- Zweiheit und Einheit.- Aufrundungsfragen.- Einwohnerzählung.- IV. Die Gegenstände des Verwaltungsrechts.- Insbesondere räumliche, wirtschaftliche, zeitliche Einheit eines Gegenstandes.- Bestandteil und Zubehör.- V. Zustände und Begebenheiten.- VI. Handlungen des einzelnen.- 1. Rechtlich gleichgültige Handlungen.- 2. Erfüllungshandlungen 237–240 (insbesondere auch Erfüllung einer Nichtschuld 238, Geschäftsführung ohne Auftrag 239).- 3. Unerlaubte Handlungen und Unterlassungen.- 4. Willenserklärungen und Entgegennahme von solchen.- VII. Handlungen des Staates oder eines sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt.- § 11. Fortsetzung. Die Verwaltungsakte, ihre Gültigkeit und Ungültigkeit.- I. Begriff des Verwaltungsakts.- II. Einteilung der Verwaltungsakte.- 1. Grundsätzlich überprüfbare und grundsätzlich unüberprüfbare Verwaltungsakte.- 2. Einseitige und zweiseitige Verwaltungsakte.- 3. Inhaltliche Unterschiede.- a) ablehnendes Verhalten (behördliche Untätigkeit, Versagung, Nichtbeanstandung, negative Beschlüsse).- b) ändernde Verwaltungsakte (Gebot, Verbot, Erlaubnis, Befreiung, Machtverleihung, -entziehung, Aufhebung, Widerruf, tatsächlicher Eingriff).- c) feststellende Verwaltungsakte.- d) zusammengesetzte Verwaltungsakte, Nebenbestimmungen.- III. Gültigkeit und Ungültigkeit der Verwaltungsakte.- 1. Unwirksamkeit, Anfechtbarkeit, Widerruflichkeit im allgemeinen.- 2. Heilbarkeit.- 3. Teilunwirksamkeit.- 4. Wahlweise eintretende Unwirksamkeit.- 5. Außergewöhnliche Gültigkeit.- IV. Fortsetzung. Unwirksamkeit, Anfechtbarkeit und Widerruflichkeit von Verwaltungsakten im einzelnen.- 1. Der unwirksame Verwaltungsakt.- a) Formfehler (insbeson¬dere auch die Frage der Möglichkeit stillschweigender Verwaltungsakte).- b) Verfahrensmängel (insbesondere auch die Frage der Gültigkeit von Akten geisteskranker und befangener Beamten).- c) Machtüberschreitung bei Unmöglichkeit des Inhalts, sachlicher und örtlicher Unzuständigkeit.- d) Sachwidrigkeit (insbesondere bei Erschleichung und Erzwingung von Verwaltungsakten).- 2. Der anfechtbare Verwaltungsakt.- 3. Widerruflichkeit von Verwaltungsakten.- a) Frei widerrufliche Verwaltungsakte.- b) Widerruf nicht frei widerruflicher Verwaltungsakte wegen Fehlerhaftigkeit und nachträglicher Umstände.- c) Der Widerruf von Verwaltungsakten nach der thüringischen Landesverwaltungsordnung.- d) Geltendmachung des Widerrufs.- § 12. Schutz gegen Übergriffe der Verwaltung.- I. Schutz durch Behördenordnung und Verfahren.- II. Einschreiten der höheren Behörde.- III. Formlose Beschwerde und Gegenvorstellung.- IV. Selbsthilfe: Ungehorsam und Widerstand gegen die Staatsgewalt.- 1. Ungehorsam gegen Polizeiverordnungen, Polizeiverfügungen und unzulässige Dienstbefehle.- 2. Widerstand gegen die Staatsgewalt.- V. Förmliche Beschwerde und Einspruch.- 1. Förmliche Beschwerde.- 2. Einspruch.- VI. Anrufung des Verwaltungsgerichts.- § 13. Fortsetzung. Rechtsschutz durch Verwaltungsgerichte.- I. Wesen der Verwaltungsrechtspflege.- 1. Nachbildung der ordentlichen Rechtspflege.- 2. Die Entscheidung als typische Aufgabe der Verwaltungsrechtspflege (Feststellungs-, Leistungs-, verneinende und bejahende Gestaltungsurteile).- 3. Rechtsstreitigkeiten als typischer Gegenstand der Verwaltungsrechtspflege.- a) Ausschluß von Ermessensfragen.- b) Entscheidung über subjektive Rechte.- 4. Streitverfahren und Parteien, Prozeß Vertretung.- 5. Abschluß des Verfahrens durch Urteil.- a) Rechtskraft des Urteils, wiederholte Verfügungen der Verwaltungsbehörden.- b) Grenzen der Rechtskraft, Beiladung.- 6. Grundzüge des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.- II. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte.- Zuständigkeitsregelung durch Einzelaufzählung 313, durch ein gemischtes System 313, durch Vereinbarung 314, durch Generalklausel.- III. Arten der Verwaltungsrechtspflege.- 1. Parteistreitigkeiten und einseitige Verwaltungsrechtspflege.- 2. Ursprüngliche und nachträgliche Verwaltungsrechtspflege, insbesondere Anfechtung polizeilicher Verfügungen in Preußen.- 3. Volle und beschränkte Verwaltungsrechtspflege, insbesondere Revision, Rechtsbeschwerde, Kassation.- IV. Kosten des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.- § 14. Fortsetzung. Amtshaftung und öffentlichrechtliche Entschädigung für schuldlos rechtswidrige Eingriffe.- I. Amtshaftung.- 1. Vermögensrechtliche Haftung.- 2. Strafrechtliche Haftung.- 3. Amtshaftung und Rechtsweg.- II. Öffentlichrechtliche Entschädigung für schuldlos rechtswidrige Eingriffe.- III. Anhang. Die öffentliche Gewalt als Werkzeug unerlaubter Handlungen Privater.- § 15. Verwaltungszwang und andere Mittel zur Verwirklichung des staatlichen Willens.- I. Zwangsvollstreckung.- 1. Zwangsvollstreckung wegen öffentlichrechtlicher Geldforderungen.- 2. Ersatzvornahme.- 3. Zwangsstrafe.- 4. Anwendung von Gewalt.- a) Beeinträchtigungen der Freiheit der Person.- b) der Unverletzlichkeit der Wohnung.- c) Waffengebrauch.- d) Siegelung und Plombierung von Sachen.- II. Zwang ohne vorangehenden förmlichen Verwaltungsakt.- III. Schutz gegen rechtswidrigen Verwaltungszwang.- 1. Bemängelung des Vollstreckungstitels.- 2. Bemängelung der Androhung des Zwangsmittels.- 3. Mängel des Verwaltungszwanges selbst.- IV. Schadensersatzansprüche des Staats oder sonstiger Träger öffentlicher Gewalt aus Verwaltungswidrigkeiten.- V. Verwaltungsstrafrecht.- Einleitung, insbesondere Ordnungsstrafe, Unterwerfungsverfahren.- 1. Eigentümlichkeiten des sog. Verwaltungsstrafrechts.- a) Frage des Verschuldens.- b) Opportunitätsprinzip.- c) Rechtskraft.- 2. Polizeistrafrecht.- 3. Finanzstrafrecht.- Besonderer Teil.- § 16. Der öffentliche Dienst.- I. Begriff.- 1. Öffentlichrechtlichkeit.- 2. Dienstherrnfähigkeit.- 3. Pflicht zur Treue.- 4. Abgrenzung gegenüber dem staatlich gebundenen Beruf.- II. Dienst, Amt, Behörde.- III. Arten des öffentlichen Dienstes.- 1. Verschiedenheit in der Person des Dienstherrn.- 2. Verschiedenheit in der Person des Dienstverpflichteten.- a) Ausübung einzelner ehrendienstlicher Tätigkeiten.- b) Dienst als Ehrenbeamter.- c) berufsmäßiger öffentlicher Dienst.- IV. Beamtenrecht (Recht des berufsmäßigen öffentlichen Dienstes).- 1. Rechtsquellen.- 2. Beginn und Ende des berufsmäßigen Staats-dienstes 363–369. Einleitung: Versorgungsanwärter 363, Zusage der Ernennung 364, dann.- a) Anstellung.- b) Übertragung eines Amtes.- c) Versetzung.- d) Amtsentziehung (Versetzung in den Wartestand, Dienstenthebung).- e) Beendigung des Dienstverhältnisses kraft Gesetzes 367, kraft zweiseitigen 367, kraft einseitigen Verwaltungsakts.- 3. Pflichten der Beamten.- a) gesetzliche Pflichten, insbesondere deren Verhältnis zu den Grundrechten.- b) Maß und Schranken des Gehorsams gegen Dienstbefehle.- 4. Dienstzwang und Dienststrafe.- a) Dienstzwang.- b) Dienststrafe und Dienststrafverfahren.- 5. Rechte der Beamten und deren Gewährleistung.- 6. Die vermögensrechtlichen Ansprüche insbesondere.- a) Entschädigung für Aufwendungen.- b) Unfallfürsorge.- c) Besoldung, Ruhegehalt, Hinterbliebenenfürsorge.- d) Gewährleistung der vermögensrechtlichen Ansprüche.- §17. Grundzüge des Finanzrechts.- I. Einleitung.- II. Gebühren.- 1. Wesen und Arten.- 2. Rechtsquellen.- 3. Entstehung und Endigung der Gebührenpflicht.- 4. Beitreibung und Rechtsschutz.- III. Beiträge.- IV. Steuern.- 1. Wesen und Arten.- 2. Rechtsquellen.- 3. Subjekte des Steuerrechts.- 4. Entstehung der Steuerpflicht, insbesondere bei den Veranlagungssteuern und im Zollrecht.- 5. Endigung der Steuerpflicht.- 6. Schutz des Steuerpflichtigen und Schutz der Steuerverwaltung.- V. Monopole.- § 18. Enteignung und öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung.- I. Die klassische Enteignung.- 1. Gesetzliche Grundlage.- 2. Gegenstand der Enteignung.- 3. Bei der Enteignung Beteiligte.- 4. Notwendigkeit des zu enteignenden Grundstücks für ein öffentliches Unternehmen.- 5. Entschädigung.- 6. Enteignungsverfahren.- a) Verleihung des Enteignungsrechts.- b) Planfeststellung.- c) Festsetzung der Entschädigung.- d) Enteignungserklärung.- e) Enteignungsverträge.- 7. Rechtsnatur der Enteignung.- II. Sonderfälle von Eigentumsentziehungen.- 1. Vereinfachtes Verfahren, insbesondere bei Festsetzung neuer Fluchtlinien.- 2. Grundstücksumlegung.- 3. Enteignung beweglicher Sachen und sonstiger, nicht unter die Enteignungsgesetze fallender Gegenstände.- 4. Enteignung durch Gesetz ohne Verwaltungsakt.- III. Sonderfälle von Eigentumsbeschränkungen durch Einzelakt.- Insbesondere nachbarliche Beschränkungen, Quellenschutz, Unterbringung Obdachloser.- IV. Gesetzliche Eigentumsbeschränkungen.- Insbesondere Verhältnis des ersten Absatzes des Art. 153 RV. zum zweiten.- § 19. Die öffentlichen Lasten (Naturalleistungspflichten).- I. Begriff der öffentlichen Last.- II. Rechtsquellen der öffentlichen Last.- 1. Gesetz.- 2. Gemeindliche Satzung.- 3. örtliches Gewohn-heitsrecht.- 4. Polizeiverordnung.- III. Arten der Lasten nach dem Kreise der verpflichteten Personen.- IV. Die tatsächlichen Voraussetzungen für die Entstehung öffentlicher Lasten.- V. Rechtsverhältnis der öffentlichen Last.- VI. Verwaltungszwang und Rechtsschutz.- § 20. Die Polizei.- I. Begriff, Arten, Erscheinungsformen der Polizei.- 1. Begriff der Polizei (Geschichte und heutiges Recht).- 2. Arten der Polizei.- a) Vorbeugende Polizei und Polizei der Strafrechts- pflege.- b) Schutzpolizei.- c) Sicherheits- und Verwaltungspolizei.- d) Orts-, Kreis-, Landespolizei.- e) Gemeinde- und Staatspolizei, Polizeikosten.- 3. Erscheinungsformen der Polizei.- II. Die rechtlichen Grundlagen der Polizeigewalt.- III. Die Grenzen der Polizeigewalt, dargestellt am ungültigen Polizeibefehl 428–448 Einleitung.- 1. Widerspruch mit einer höheren Norm.- 2. Machtüberschreitung.- a) Unzulässigkeit des Mittels (insbesondere räumliche Schranken, Verbot der Weiterübertragung der Polizei¬gewalt, gegenseitige Vertauschung von Polizeiverordnungen und -Verfügungen).- b) Nichtbeachtung der beiden Grenzen der Polizeigewalt 432–441 (Grenze der Schädlichkeit 432, Grenze des Übermaßes 433, Ver¬bot polizeilicher Schikane 433, unzuständigen Einschreitens 433, der Wohl¬fahrtspflege 434, des Schutzes reiner Privatinteressen 434, polizeilicher Bequemlichkeit 436, des Einschreitens gegen bloß mögliche Gefahren 437, gegen bloße Belästigungen 437, übermäßiger 439, ungeeigneter 440, unzu¬länglicher 440, schädlicher Befehle 441).- c) Besonderheiten der Polizeierlaubnis.- d) richtiger und falscher Adressat eines Polizeibefehls 442–446 (Gewalthaber 442, Verursacher 443, Frage des Verschuldens 444, Veranlasser 444, Inhaber des Gegenmittels 445, Erweiterung des Kreises der Verpflichtbaren in besonderen Fällen 445).- e) Überschreitung selbst¬gezogener Schranken 446. insbesondere Selbstbindung der Polizei durch eigene Grundsätze und Verbot ungleichmäßiger Behandlung.- 3. Widerspruch mit den Tatsachen.- 4. Unzulässigkeit dem Befehle zugrunde liegender Erwägungen, Vorwand.- §21. Fortsetzung. Einzelne Zweige der Polizei.- Gliederung des Paragraphen.- I. Polizei des körperlichen Wohlbefindens.- 1. Gesundheitspolizei, insbesondere Seuchenbekämpfung und Irren¬fürsorge.- 2. Unfallpolizei.- a) Feuerpolizei.- b) Polizei anderer ge-fährlicher Naturkräfte.- c) Verkehrspolizei, insbesondere Kraftwagen- und allgemeine Straßenverkehrspolizei.- d) Regelung des Verkehrs mit Giften, Geheimmitteln und Arzneien.- 3. Bau-und Wohnungspolizei.- a) Ansiedelungs-, Baugenehmigung, Städtebauwesen.- b) Bauabnahme.- c) Wohnungsaufsicht, Wohnungsbeschlagnahme 460, d) Abbruch bestehender Gebäude.- 4. Polizei der Nutzgüter.- a) Maßregeln gegen Pflanzenschädlinge.- b) Feld- und Forstpolizei.- c) Viehseuchen- und Viehzuchtgesetze, Körordnungen.- d) Jagd- und Fischereipolizei.- e) Lebensmittelpolizei.- 5. Polizeiliche Regelung des Heilwesens.- a) Ärztliche Tätig-keit.- b) Apotheker und Apotheken.- c) Errichtung privater Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten.- d) Hebammenwesen.- II. Sittenpolizei.- 1. Bekämpfung der Trunksucht.- 2. Bekämpfung des unehelichen Geschlechtsverkehrs.- 3. Bekämpfung der Tierquälerei.- 4. Bekämpfung des Glückspiels.- 5. Polizei der Vergnügungen.- 6. Fortsetzung. Theater- und Lichtspielpolizei.- III. Polizei der sonstigen geistigen Güter.- 1. Verunstaltungsgesetze 473..- 2. Kunst-, Denkmal-, Natur- und Heimatschutz 474..- 3. Bevorzugung der echten Kunst vor der Lustbarkeit.- IV. Polizei der überwachungsbedürftigen menschlichen Betätigungsformen.- mit Hinweisen auf die Fund-,die Strandpolizei und die Polizei der öffentlichen Sammlungen.- 1. Waffenpolizei.- 2. Paß- und Aufenthaltspolizei.- a) Paßpolizei.- b) Aufenthaltspolizei 479–482 (Ausweisung von Ausländern 479, Aufenthaltsbe¬schränkungen Deutscher nach dem Freizügigkeitsgesetz 479, Fremden¬polizei 481, Polizei des Wanderns, insbesondere Zigeunerpolizei 481, Aus¬wanderungspolizei 481).- 3. Pressepolizei 482–486: Einleitung mit Hinweisen auf Geschichte und Rechtsquellen 482, dann.- a) Gegenstand der Pressepolizei.- b) Wesen der Pressefreiheit.- c) Ordnungsvorschriften.- d) Zuständigkeiten beim Einschreiten gegen Mißbräuche der Presse.- 4. Vereins- und Versammlungspolizei,Maßnahmen gegenAufruhr486–490: Einleitung mit Hinweis auf die Rechtsquellen 486, dann.- a) Begriff des Vereins und der Versammlung.- b) Wesen der Vereins- und Versammlungsfreiheit.- c) Polizei der öffentlichen Umzüge 489, d) Ma߬nahmen gegen Aufruhr.- 5. Gewerbepolizei 490–500: Geschichtliche Einleitung 490, dann.- a) Begriff des Gewerbes.- b) Wesen der Gewerbefreiheit.- c) die drei Formen des Gewerbebetriebs 493–499 (stehender Gewerbebetrieb 494, Gewerbebetrieb im Umherziehen 497, Marktverkehr 498).- d) gewerbliche Taxen und sonstige Höchst- oder Mindestpreise.- §22. Die öffentlichen Sachen und Anstalten. — Grundzüge des Schulrechts.- I. Die öffentlichen Sachen.- mit Überblick über die Arten des öffentlichen Vermögens: Finanz vermögen, Allmenden, Verwaltungsvermögen, öffentliche Sachen.- 1. Die Rechtsquellen für das Recht der öffentlichen Sachen.- 2. Die Rechtssubjekte (Nutzer, Eigentümer, Unterhaltungs-pflichtiger, Herr der öffentlichen Sache — öffentliches Eigentum).- 3. Entstehungs- und Endigungstatbestände einer öffentlichen Sache, insbesondere Widmung und Einziehung.- 4. Rechtsverhältnisse an öffentlichen Sachen.- a) Gemeingebrauch.- b) durch Gebrauchserlaubnis erlangte Befugnis.- c) verliehenes Nutzungsrecht.- 5. Erledigung von Streitigkeiten über öffentliche Sachen.- II. Die öffentlichen Anstalten.- 1. Privatrechtlich und öffentlichrechtlich betriebene Anstalten.- 2. Rechtsquellen des öffentlichen Anstaltsrechts.- 3. Träger der öffentlichen Anstalten.- 4. Die anstaltlichen Rechtsverhältnisse, ihre Entstehungs- und Endigungsgründe.- a) Rechte des Nutzers.- b) Rechte der Anstalt, insbesondere die Anstaltsgewalt.- 5. Gewährleistung der Rechtsverhältnisse.- III. Fortsetzung. Die öffentlichen Schulen; Unterricht und Erziehung.- 1. Die öffentlichen Schulen.- a) Rechtsquellen.- b) Arten der Schulen 517–522 (insbesondere Volksschulen 518, Fortbildungs- oder Berufsschulen 520, höhere Schulen 520, Universitäten 521, Fachschulen und Fachhochschulen 522).- c) Schule und Kirche.- 2. Privatschulen und Privatunterricht.- 3. Erziehung, insbesondere Schutzaufsicht und Fürsorgeerziehung.- §23. Verwaltung durch beliehene öffentliche Unternehmer und Selbstverwaltung.- I. Verwaltung durch beliehene öffentliche Unternehmer.- 1. Begriff und Vorkommen.- 2. Die preußischen Kleinbahnen insbesondere.- II. Selbstverwaltung.- 1. Rechte und Pflichten der Gemeinde und sonstiger Selbstverwaltungskörper, insbesondere Bedeutung der Selbstverwaltungs¬und der Auftragsangelegenheiten.- 2. Die staatliche Kommunalaufsicht 532–535. Einleitung: Rechtsbewahrung als grundsätzliches Ziel der Aufsicht 532, dann.- a) Mittel der Aufsicht, insbesondere Ratschläge, Besichtigungen, Erkundigungen, Aufsichtsbefehle, Beanstandungen, vorbehaltene Zustimmungen, Genehmigungen und Bestätigungen.- b) Verwaltungszwang, insbesondere Zwangseinschreibung, kommissarische Verwaltung, strafendes Einschreiten.- c) Rechtsmittel gegen Maßnahmen der Aufsichtsbehörde.- III. Besondere Zweige der Selbstverwaltung: 1. Öffentliche Fürsorge.- 1. Rechtsquelle des öffentlichen Fürsorgerechts.- 2. Gegenstand der öffentlichen Fürsorge.- 3. Träger der öffentlichen Fürsorge.- 4. Unterstützungsfall und vorläufige Unterstützung.- 5. Erstattungsansprüche.- 6. Recht der Fürsorgeverbände auf Übernahme und Übergabe des Hilfsbedürftigen.- 7. Rechtsschutz.- IV. Fortsetzung. 2. Arbeiter-, Angestellten- und Arbeitslosenversicherung.- Geschichtlicher Überblick.- 1. Träger der sozialen Versicherung.- 2. Die versicherten Personen.- 3. Finanzierung der Versicherung.- 4. Gegenstand der Versicherung und Ansprüche der Versicherten.- a) Krankenversicherung.- b) Unfallversicherung.- c) Invalidenversicherung.- d) Angestelltenversicherung.- e) Arbeitslosenversicherung.- 5. Entscheidung über die Versicherungsansprüche.