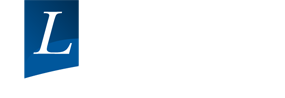Grundlagen der Bodenmechanik, Softcover reprint of the original 1st ed. 1967
Langue : Allemand
Auteurs : Caquot Albert, Kerisel J.
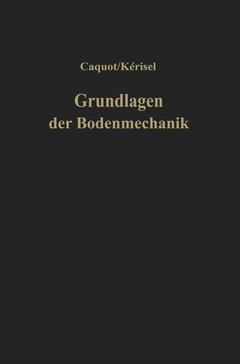
AuBerdem berichtet das Buch vom Mechanismus der Beanspruchun gen, die beim Entleeren in Silos entstehen, Beanspruchungen, die von einem Grenzgleichgewicht des passiven Drucks herriihren. SchlieBlich erachteten es die Verfasser fiir notig, auf die Bedeutung der Rheologie bei Boschungsrutschungen hinzuweisen. Dies sind die hauptsachlichsten neuen Aspekte der vorliegenden Auflage. A.Caquot J. Kerisel Vorwort zur deutschen Ausgahe Mit der vorliegenden deutschen Ausgabe des "Traite de Mecanique des Sols" wird den Fachkollegen im deutschen Sprachraum das franzosi sche Standardwerk der Bodenmechanik vorgestellt. Es ist das Ergebnis langjahriger theoretischer und praktischer Untersuchungen der beiden franzosischen V erfasser. Der Dbersetzer war bei seiner Arbeit bemiiht, die Originalitat des Werkes moglichst zu wahren. In diesem Bestreben wurden z. B. nur die Formelzeichen geandert, die im deutschsprachigen bodenmechanischen Schrifttum ilnen festen Platz haben, die iibrigen aber - besonders wenn sie die Theorien der franzosischen Verfasser betreffen - nach Moglichkeit unverandert iibernommen. 1m Einvernehmen mit den franzosischen Verfassern wurden Erganzungen und Textanderungen in die deutsche Ausgabe aufgenommen, urn diese dem neuesten Stand der bodenmecha nischen Entwicklung anzupassen oder urn eine noch groBere Verstand lichkeit zu erzielen. Die deutsche Ausgabe enthiilt dariiber hinaus ein eingehendes Sachverzeichnis, das dem Leser die Benutzung des Werkes wesentlich erleichtern wird. Bei del' oft recht schwierigen Dbersetzungsarbeit war dem Dber setzer die tatkraftige Unterstiitzung von Monsieur J. KERISEL besonders wertvoll. Fiir seine Hilfe bei der Beschaffung von Bildern und seine mannigfaltigen Ratschlage sei ihm an dieser Stelle recht herzlich gedankt.
Einführung.- Die physikalischen Eigenschaften der Böden.- 1 Die Festsubstanz.- 1.1 Beiträge der Geologie.- 1.2 Beiträge der Bodenkunde.- 1.3 Beiträge der Mineralogie.- 1.4 Beiträge der Korngrößenanalyse.- 1.4.1 Darstellung der Korngrößen.- 1.4.2 Einteilung der Böden nach der Kornverteilung.- 1.4.3 Spezifische Oberfläche.- 1.5 Beiträge der Optik.- 1.6 Beiträge der Kristallographie.- 1.6.1 Struktur der Tone.- 1.6.2 Drei große Tonmineral-Familien, die für die Kristallographie, Mineralogie und spezifische Oberfläche charakteristisch sind: Kaolinite, Illite und Montmorillonite.- 1.7 Beiträge der Chemie.- 1.8 Allgemeine Einteilung der Tone.- 2 Die flüssigen Bestandteile.- 2.1 Differentialthermoanalyse: Das Konstitutionswasser.- 2.2 Thermoponderalanalyse.- 2.3 Das adsorbierte Wasser.- 2.4 Wassergehalt.- 2.4.1 Experimentelle Bestimmung des Wassergehaltes im Laboratorium.- 2.4.2 Bestimmung des Wassergehaltes in situ.- 2.5 Porenziffer und Porenanteil.- 2.5.1 Porenziffer.- 2.5.2 Porenanteil.- 2.5.3 Experimentelles Bestimmen der Porenziffer.- 2.5.4 Messen der Reinwichte ?s.- 2.5.5 Typische Werte für die Porenziffer und den Porenanteil bei Sanden.- 2.5.6 Verteilung der Hohlräume in den Tonen.- 2.5.7 Gründe für die Anisotropie der Böden.- 2.6 Elektrolyte und Kationen in den Böden.- 2.6.1 Rolle der im Wasser enthaltenen Elektrolyten.- 2.6.2 Kationenaustauschvermögen.- 2.6.3 Energie, mit der die Kationen an die Tonkörner gebunden sind.- 2.6.4 Saure oder basische Reaktionen der Böden.- 2.6.5 Beschleunigung des Kationenaustausches mit der Temperatur.- 2.7 Atterbergsche Konsistenzgrenzen.- 2.7.1 Einfluß der flüssigen Phase auf den Zustand des Bodens.- 2.7.2 Experimentelle Bestimmung der Konsistenzgrenzen.- 2.7.3 Genauigkeit der Konsistenzgrenzenbestimmung.- 2.7.4 Beziehung zwischen der Bildsamkeit und der Fließgrenze.- 2.8 Bedeutung der Atterbergschen Versuche.- 2.9 Atterbergsche Konsistenzgrenzen von Bodengemischen.- 2.10 Kritik des Gewichtsprozent-Kriteriums zur Definition der Bodeneigenschaften.- 3 Die gasförmigen Bestandteile.- 3.1 Das gasförmige Element.- 3.2 Physikalische Beziehungen zwischen der gasförmigen Phase und den beiden anderen Phasen.- 4 Dreiphasensystem: Festsubstanz — Flüssigkeit — Gas.- 4.1 Wichten.- 4.1.1 Allen drei Phasen gemeinsame Wichte: Rohwichte des natürlichen gewachsenen Bodens.- 4.1.2 Wichte der festen Phase: Rohwichte des trockenen Bodens.- 4.1.3 Größenordnung der Rohwichten des trockenen und des natürlichen gewachsenen Bodens.- 4.1.4 Wichte unter Auftrieb.- 4.2 Durchlässigkeit.- 4.2.1 Messung des Durchlässigkeitskoeffizienten im Laboratorium.- 4.2.2 Messung des Durchlässigkeitskoeffizienten in situ.- 4.2.2.1 Methode von Matsuo und Akai.- 4.2.2.2 Anwendung der Dupuitschen Formel.- 4.2.3 Größenordnung der Durchlässigkeitskoeffizienten.- 4.2.4 Die Hauptfaktoren, die den Durchlässigkeitskoeffizienten beeinflussen.- 4.2.5 Durchlässigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur.- 4.2.6 Durchlässigkeit in Abhängigkeit von den austauschbaren Kationen.- 4.2.7 „Schwimmsand“.- 4.2.8 Durchlässigkeit für feste Stoffe: Filterbedingung.- 4.2.9 Innere Erosion.- 4.3 Kapillarität.- 4.3.1 Grundlagen.- 4.3.2 Energiebetrachtungen zur Kapillarität.- 4.3.3 Vorrichtungen für das Messen von H (Kapillarimeter).- 4.3.3.1 Messen von H in situ.- 4.3.3.2 Messungen im Laboratorium.- 4.3.4 Ergebnisse.- 4.3.4.1 Allgemeiner Zusammenhang zwischen H und dem Wassergehalt.- 4.3.4.2 Bereich der kleinen H-Werte — H-Werte für eine gesättigte Bodenprobe.- 4.3.4.3 Welkepunkt.- 4.3.4.4 Veränderung des Dampfdrucks in der gasförmigen Phase eines Bodens.- 4.3.5 Verteilung des Wassers im Boden: Bodenfeuchteprofile.- 4.3.6 Wirkung der Undurchlässigkeit des Bodens auf den Wassergehalt.- 4.3.7 Ermittlung des Wassergehaltes unter einer undurchlässigen Deckschicht bei konstanter Temperatur.- 4.3.8 Kapillarität und Durchlässigkeit.- 4.3.9 Geschwindigkeit des kapillaren Anstiegs.- 4.4 Wärmeerscheinungen in den Böden.- 4.4.1 Sinken der Temperatur: Bodenfrost.- 4.4.2 Mechanismus der Wasserbewegung in ungesättigten Böden unter der Einwirkung eines Temperaturgefälles.- 4.4.3 Ausbreitung thermischer Wellen.- 4.5 Elektrische Erscheinungen in Böden.- 4.5.1 Fortpflanzung der Elektrizität im Boden.- 4.5.2 Gründe für die Leitfähigkeit der Böden.- 4.5.3 Messung des spezifischen Widerstands in situ.- 4.5.4 Elektrische Untersuchung von Bohrlöchern.- 4.5.5 Natürliche elektrische Ströme.- 4.5.6 Anwendung der Elektrizität auf die Messung der Anisotropie.- 4.5.7 Übergang vom anisotropen zum isotropen Zustand.- 4.5.8 Elektroosmose und elektrochemische Erscheinungen.- Mechanische Eigenschaften des Dreiphasensystems.- 5 Ermittlung der Spannungs-Dehnungs-Diagramme im Laboratorium bei kleinen Verformungen.- 5.1 Definitionen der elastischen und plastischen Bereiche sowie der Bereiche mit großer Verformung.- 5.2 Verformungen bei völlig behinderter Seitenausdehnung-Kompressionsversuch.- 5.2.1 Definitionen.- 5.2.2 Versuchsausführung.- 5.2.3 Systematischer Fehler, der sich beim Arbeiten mit dem Kompressionsgerät ergibt.- 5.3 Verformungen bei partiell behinderter Seitenausdehnung.- 5.3.1 Hydrostatische Belastung der Bodenprobe mit Hufe einer Gummihülle.- 5.3.2 Dreiaxial versuch: Kombination eines hydrostatischen Druckes mit einem auf die starren Stirnflächen der Bodenprobe ausgeübten Druck oder Zug.- 5.4 Allgemeine Ergebnisse.- 5.4.1 Sande.- 5.4.1.1 Ergebnisse mit dem Kompressionsgerät.- 5.4.1.2 Ergebnisse mit dem Gerät nach Abb. 5.3.- 5.4.1.3 Ergebnisse mit dem Dreiaxialgerät.- 5.4.1.4 Analogie mit den an Felsgesteinen vorgenommenen Druckversuchen.- 5.4.1.5 Einige charakteristische Zahlen.- 5.4.2 Tone.- 5.4.2.1 Zeit.- 5.4.2.2 Druckzuwachszahl.- 5.4.2.3 Ergebnisse mit dem Kompressionsgerät.- 5.4.2.4 Mit dem Dreiaxialgerät und dem Gerät nach Abb. 5.3 erhaltene Ergebnisse.- 5.4.2.5 Konsolidierungsdrücke. Normalkonsolidierte Tone.- 5.4.2.6 Isotrope und anisotrope Konsolidierung.- 5.4.2.7 Gestalt der Druckentlastungskurven: Quelltone.- 5.4.2.8 Einfluß der Störung der Bodenprobe.- 5.5 Vorherige Sättigung der Bodenprobe.- 5.5.1 Versuchseinrichtung.- 5.5.2 Abhängigkeit der adsorbierten Wassermenge von der Zeit.- 5.5.3 Zusammenhang zwischen Volumenänderung und Adsorption.- 5.5.4 Aufbringen eines Druckes während der Adsorption.- 5.6 Abhängigkeit der Steifezahl von der Art der adsorbierten Kationen.- 5.7 Schlußfolgerungen bezüglich des Elastizitäts- bzw. Deformationsmoduls.- 5.8 Messung der zweiten Elastizitätsgröße. Scherverformung.- 6 Setzungsberechnung. Verteilung der Verformungen und Spannungen im Boden.- 6.1 Boussinesqsche Theorie für den elastisch-isotropen Halbraum, der an seiner Oberfläche durch eine lotrechte Einzellast beansprucht wird..- 6.2 Anwendung der Boussinesqschen Theorie auf die Berechnung der Verformung der Böden.- 6.2.1 Lotrechte, an der Oberfläche eines Bodens wirkende Einzellast..- 6.2.2 Mehrere lotrechte Einzellasten an der Oberfläche eines Bodens.- 6.2.3 Schichten mit unterschiedlichen Elastizitätsmoduln.- 6.2.4 Gleichmäßig verteilte lotrechte Lasten, die durch eine (schlaffe) Membran auf den Boden übertragen werden.- 6.2.4.1 Membran mit kreisförmiger Begrenzung.- 6.2.4.2 Membran mit rechtwinkeliger Begrenzung.- 6.3 Gleichmäßig oder nicht gleichmäßig verteilte lotrechte Lasten, die mit Hilfe von starren Platten auf den Boden eingetragen werden. Spannungen und Verformungen an der Oberfläche.- 6.4 Allgemeine Formel für die Berechnung der Verformungen der Oberfläche des Bodens unter einer belasteten biegsamen oder einer starren Platte..- 6.5 Anwendung der Boussmesqschen Theorie auf die Berechnung der Spannungen der Böden.- 6.6 Berechnung der Verformungen des elastisch-isotropen Halbraums unter der Wirkung einer nicht an der Oberfläche des Halbraums angreifenden lotrechten Einzellast.- 6.7 Berechnung der Spannungen im elastisch-isotropen Halbraum unter der Wirkung einer nicht an der Oberfläche des Halbraums angreifenden Einzellast.- 6.7.1 Beanspruchung in der Nähe der Pfahlspitze.- 6.8 Überprüfung der Theorie durch den Versuch.- 6.9 Messung des Elastizitätsmoduls E in situ.- 6.9.1 Messung des Elastizitätsmoduls E in den Böden mit Hilfe der Bettungszahl. Ungenauigkeit dieser Methode.- 6.9.2 Messung des Elastizitätsmoduls E im Fels.- 7 Verformungen in Abhängigkeit von der Zeit.- 7.1 Primäre und sekundäre Konsolidierung.- 7.2 Primäre Konsolidierung.- 7.2.1 Situation im Augenblick der Belastung.- 7.2.1.1 Verteilung der Spannungen zwischen Flüssigkeit und Festsubstanz.- 7.2.1.2 Bestimmung der zuBeginn der Primärkonsolidierung in der Flüssigkeit herrschenden Überdrücke im Falle eines den Halbraum ausfüllenden Bodens und einer an der Oberfläche des Halbraums angreifenden Einzellast.- 7.2.1.3 Ermittlung des Gesamtvolumens des zu Beginn der Primärkonsolidierung abfließenden Wassers im Falle eines den Halbraum ausfüllenden Bodens und einer an der Oberfläche des Halbraums angreifenden Einzellast.- 7.2.2 Konsolidierungstheorie im allgemeinen Fall.- 7.2.3 Sonderfall der Konsolidierungstheorie: Gleichförmig belastete Schicht endlicher Dicke, die an beiden Seiten dräniert ist.- 7.2.3.1 Anwendungsbeispiel.- 7.2.3.2 Ermittlung des Durchlässigkeitskoeffizienten k im Kompressionsgerät.- 7.2.3.3 Charakteristische Werte des Konsolidierungskoeffizienten c? = Esk/?w.- 7.3 Konsolidierung eines Geländes mit Hilfe lotrechter Dräns.- 7.4 Sekundäre Konsolidierung.- 7.5 Kriecherscheinungen beim Abscheren: Viskosität der Tone.- 8 Akustische Erscheinungen und Schwingungserscheinungen in Böden.- 8.1 Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls in festen Körpern.- 8.1.1 Klassische Formeln.- 8.1.2 Zusammenfassung der an Gesteinen erzielten Ergebnisse.- 8.2 Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls in Böden.- 8.2.1 Laboratoriumsmessungen.- 8.2.2 In-situ-Messungen. Anwendung auf die Bodenerkundung.- 8.2.3 Folgerungen aus denMessungen für denWert d.Elastizitätsmoduls E.- 8.2.4 Erzeugung der Wellen.- 8.3 Schwingungen.- 8.3.1 „Eigenfrequenz” der Böden.- 8.3.2 Versuche zur Bestimmung einer „Eigenfrequenz“ der Böden.- 8.3.3 Faktoren, die die „Eigenfrequenz“ der Böden beeinflussen.- 8.3.3.1 Einfluß der angreifenden Kräfte.- 8.3.3.2 Einfluß der Form der Gründungen und ihrer Abmessungen.- 8.3.3.3 Einfluß des Wassergehaltes.- 8.3.4 Allgemeine Ergebnisse.- 8.4 Gestaltung der Maschinenfundamente.- 9 Gleichgewichtsbedingungen der Materie.- 9.1 Darstellung der Spannungen nach Mohr.- 9.2 Mohrsche Hüllkurve der Materie.- 9.2.1 Isotrope Medien.- 9.2.1.1 Einaxiale Druck- und Zugfestigkeit.- 9.2.1.2 Scherfestigkeit.- 9.2.1.3 Gestalt der Mohrschen Hüllkurve isotroper Stoffe.- 9.2.2 Anisotrope Medien Theorie der Anisotropie.- 9.2.2.1 Isotrope und homogene Stoffe.- 9.2.2.2 Anisotrope Stoffe.- 9.3 Gestalt der Mohrschen Hüllkurve für Böden.- 9.3.1 Rollige, trockene Böden.- 9.3.1.1 Gleichgewichtsbedingungen.- 9.3.1.2 Grenzverhältnis der Hauptspannungen.- 9.3.2 Rollige, wassergesättigte Böden. Fehlende Hüllkurve für die Gesamtheit der beiden Phasen.- 9.3.3 Bindige Böden.- 9.4 Zusammenhang zwischen den bindigen und rolligen Böden. Theorem der korrespondierenden Zustände.- 9.4.1 Anwendung des Theorems der korrespondierendenZustände auf die Berechnung des Grenzverhältnisses der Hauptspannungen in einem bindigen, sich im Grenzgleichgewicht befindenden Boden. Einaxiale Zug- und Druckfestigkeit eines bindigen Bodens.- 9.5 Anisotropie der Böden.- 9.6 Gleichzeitiges Vorhandensein einer plastischen und einer elastischen Zone in einem Boden. Allgemeine Betrachtung der Methoden zur Berechnung der Spannungen.- 10 Schervorgang in rolligen Böden.- 10.1 Abscheren längs einer vorgegebenen Ebene.- 10.1.1 Translations-Schergeräte (Rahmenschergeräte).- 10.1.2 Torsions-Schergeräte.- 10.1.3 Rotations-Schergeräte (Ringschergeräte).- 10.2 Dreiaxialgerät.- 10.2.1 Vor- und Nachteile des Dreiaxialgerätes.- 10.2.2 Abmessungen der Bodenprobe.- 10.2.3 Anisotropie, die im Laboratorium bei der Herstellung der Bodenprobe entsteht.- 10.2.4 Vorbereitung der Bodenprobe für den Versuch.- 10.2.5 Konsolidierung der Bodenprobe.- 10.2.6 Einfluß der Gummihülle auf die Versuchsergebnisse.- 10.2.7 Arbeitsweise beim Dreiaxialversuch: Kontrollierte Spannungen oder kontrollierte Verformungen.- 10.2.8 Ausführung des Dreiaxialgerätes. Messung der Spannungen und Verformungen.- 10.2.9 Messung von Volumenänderungen.- 10.2.10 Berechnung und Darstellung der Versuchsergebnisse.- 10.2.11 Die verschiedenen Versuchsmöglichkeiten.- 10.2.12 Einfluß des Vorzeichens des Spannungsdeviators auf den Reibungswinkel.- 10.3 Allgemeine Ergebnisse.- 10.3.1 Änderung des Reibungswinkels mit der Porenziffer. Entflechtungsarbeit der Körner. Kritische Porenziffer.- 10.3.2 Hysterese.- 10.3.3 Gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Reibungswinkel und Porenziffer. Charakteristische Werte für den Reibungswinkel.- 10.3.4 Abhängigkeit des Reibungswinkels von der Rauhigkeit der Körner.- 10.3.5 Abhängigkeit des Reibungswinkels von der Form und Größe der Körner.- 10.3.6 Einfluß des Wassers auf den Reibungswinkel.- 10.3.7 Abhängigkeit der Versuchsergebnisse vom benutztenVersuchs-gerät.- 10.4 Beziehung zwischen der Reibung eines kohäsionslosen Bodens und der Reibung der Materie.- 10.5 Obere Grenze der Scherbeanspruchung in einem rolligen Boden.- 10.6 Anwendungsbeispiel zur Theorie der Anisotropie.- 11 Schervorgang in bindigen Böden.- 11.1 Allgemeines.- 11.2 Einteilung der Versuche für bindige Böden.- 11.3 Vorbemerkung über den Einfluß der Versuchsgeschwindigkeit auf den Scherwiderstand bei In-situ- und Laboratoriumsversuchen: Viskosität der Tone.- 11.4 Versuch mit der Flügelsonde.- 11.4.1 Prinzip.- 11.4.2 Ausführung.- 11.4.3 Versuchsergebnisse.- 11.4.4 Vergleich mit anderen Versuchen.- 11.5 Plattendruck- und Stanzversuche.- 11.5.1 Druckversuche mit Platten, die auf der Bodenoberfläche aufliegen.- 11.5.2 Druckversuche mit Platten, die im Boden gelagert sind.- 11.5.3 Stanzversuche.- 11.6 Zugversuch mit dem Isehymeter.- 11.7 Einteilung der Laboratoriumsversuche für bindige Böden.- 11.8 Zylinderdruckversuch.- 11.8.1 Zusammenhang zwischen der Zylinderdruckfestigkeit und der Kohäsion.- 11.8.2 Kennzeichen des Zylinderdruckversuches.- 11.8.3 Praktische Ausführung des Zylinderdruckversuches.- 11.8.4 Neigung der Gleitflächen.- 11.8.5 Einfluß der Belastungsgeschwindigkeit. Kriechen.- 11.8.6 Kritik des Versuches.- 11.8.7 Ergebnisse.- 11.8.8 Bedeutung des Wassergehaltes.- 11.9 Scherversuche.- 11.9.1 Kennzeichen der Versuche.- 11.9.2 Gestaltung des Rahmenschergerätes.- 11.9.3 Größe der Normalspannungen beim Scherversuch.- 11.9.4 Schergeschwindigkeit.- 11.9.5 Ergebnisse.- 11.10 Dreiaxialversuche.- 11.10.1 Kennzeichen der Versuche: Möglichkeit und Grenzen.- 11.10.2 Messung der Porenwasserdrücke.- 11.10.3 Technische Ausführung des Dreiaxialgerätes.- 11.10.4 Konsolidierung der Bodenprobe.- 11.10.5 Versuchsgeschwindigkeit im Dreiaxialversuch.- 11.10.6 Form der Gleitflächen.- 11.11 Ergebnisse aus den Versuchen mit dem Rahmenschergerät und dem Dreiaxialgerät.- 11.11.1 Dränierte Versuche.- 11.11.1.1 Gestörter Ton (Tonmasse).- 11.11.1.2 Gestörter und anschließend konsolidierter Ton..- 11.11.1.3 Gestörter, konsolidierter und anschließend entlasteter Ton.- 11.11.1.4 Werte für cd, ?d und H für eine Tonmasse.- 11.11.1.5 Werte für ?d und cd bei natürlichen Tonen.- 11.11.2 Nichtdränierte Versuche.- 11.11.2.1 Versuche ohne Konsolidierung.- 11.11.2.2 Nach der Konsolidierung vorgenommene Versuche.- 11.11.3 Nichtdränierter Versuch mit Porenwasserdruckmessung und Darstellung der effektiven Spannungen.- 11.12 Sensibilität der Tone.- 11.12.1 Ergebnisse.- Anwendung der Bodenmechanik auf das Bauwesen.- 12 Entnahme von Bodenproben.- 12.1 Allgemeines.- 12.2 Die beiden Gütefaktoren zum Kennzeichnen eines Entnahmegerätes..- 12.3 Entnahme von Bodenproben aus Tonböden.- 12.3.1 Maximalwerte der Gütefaktoren.- 12.3.2 Beschädigungen der Bodenprobe durch das Entnahmegerät..- 12.3.3 Entnahmegerät mit feststehendem Kolben.- 12.3.4 Entnahmegerät nach Kjellmann.- 12.3.5 Verwendung der Bodenprobe im Laboratorium.- 12.3.6 Kriterium für eine korrekte Entnahme.- 12.4 Entnahme von Bodenproben im Sand.- 13 Einteilung der Böden.- 13.1 Allgemeine Untersuchung eines Baugeländes.- 13.2 Einteilung der Böden nach ihren physikalischen Eigenschaften.- 14 Bodenverbesserung.- 14.1 Allgemeine Betrachtungen.- 14.2 Stabilisieren durch Zugabe geeigneter Böden.- 14.3 Verdichtung.- 14.3.1 Verdichten im Laboratorium.- 14.3.2 Verdichten auf der Baustelle.- 14.3.2.1 Verdichten durch Walzen.- 14.3.2.2 Verdichten durch Rüttelplatten.- 14.3.2.3 Stampfer.- 14.3.3 Vergleich der im Laboratorium und auf der Baustelle erzielten Verdichtungen.- 14.3.4 Verlauf der Verdichtung in Abhängigkeit von der Zeit.- 14.4 Stabilisierung mit Zement.- 14.5 Stabilisierung mit Bitumen.- 14.6 Chemische Stabilisierung durch Verminderung des Wasserabsorptionsvermögens des Bodens.- 14.7 Stabilisierung durch Zugabe von Polymeren.- 14.8 Schwerkraft-Dränung.- 14.8.1 Waagerechte Gräben oder Dräns.- 14.8.2 Lotrechte Dräns.- 14.9 Erzwungene Dränung.- 14.9.1 Erzwungene Dränung durch Wasserentzug.- 14.9.2 Erzwungene Dränung durch Belastung.- 14.9.3 Erzwungene Dränung durch Elektroosmose.- 15 Allgemeine Theorie des Erddrucks und Erdwiderstands.- 15.1 Beziehungen zwischen konjugierten sowie orthogonalen Spannungen in der Umgebung eines Punktes in einem rolligen Boden im Falle des ebenen elastischen Grenzgleichgewichts.- 15.1.1 Beziehungen zwischen konjugierten Spannungen.- 15.1.2 Beziehung zwischen orthogonalen Spannungen.- 15.2 Definition des Erddrucks und des Erdwiderstands.- 15.3 Theorie von Coulomb.- 15.4 Theorie von Rankine-Lévy-Considère.- 15.5 Theorie von Bottssinesq-Resal.- 15.6 Allgemeine Theorie des Erddrucks und Erdwiderstands unter Berücksichtigung von Spannungen konstanter Richtung und auf Radialebenen proportional mit dem Abstand von der freien (unbelasteten) Oberfläche der Erdmasse zunehmender Größe (Theorie von Bous-sinesq-Caquot).- 15.6.1 Aufgabenstellung.- 15.6.2 Allgemeine Gleichgewichtsgleichungen.- 15.6.3 Die Funktion m.- 15.7 Berechnung der Erddruckspannungen.- 15.7.1 Partikularlösung.- 15.7.2 Allgemeine Lösung.- 15.7.3 Ergebnisse.- 15.7.3.1 Einfluß des Winkels a.- 15.7.3.2 Einfluß des Reibungswinkels ?.- 15.7.3.3 Vergleich mit der Cotrlombschen Theorie. Allgemeine Formeln.- 15.7.4 Hüllkurven der auf den Radialebenen wirkenden Spannungen.- 15.7.5 Gleitlinien.- 15.8 Berechnung der Erdwiderstandspannungen.- 15.8.1 Partikularlösung.- 15.8.2 Allgemeine Lösung.- 15.8.3 Ergebnisse.- 15.8.3.1 Einfluß des Winkels ?.- 15.8.3.2 Einfluß des Reibungswinkels ?.- 15.8.3.3 Vergleich mit der Cotrlombschen Theorie.- 15.8.4 Hüllkurven der auf denRadialebenen wirkenden Spannungen.- 15.8.5 Gleitlinien.- 15.9 Gemeinsame Probleme bei Erdwiderstand- und Erddruckberechnungen: Auf lasten und bindige Böden.- 15.9.1 Gleichmäßig verteilte, an der freien Oberfläche wirkende Flächenlast.- 15.9.1.1 Prinzip der Methode: Superposition von Gleichgewichtszuständen.- 15.9.1.2 Berechnung der resultierenden Spannungen.- 15.9.2 Linienlast an der freien Oberfläche parallel zurWandoberkante.- 15.9.3 Punktlast.- 15.9.4 Bindige Böden.- 15.9.5 Grenzhöhe freistehender Geländestufen.- 15.9.6 Angaben über die einzusetzenden Kohäsionswerte.- 15.9.7 Wirkung des Wassers im Falle des Erddrucks.- 15.10 Erddruck- und Erdwiderstandversuche.- 15.10.1 Die hauptsächlichsten Stützkonstruktionen.- 15.10.1.1 Schwergewichtmauern.- 15.10.1.2 Winkelstützmauern.- 15.10.1.3 Spundwände.- 15.10.2 Konstruktionen, die den Erdwiderstand wecken.- 15.10.3 Versuche mit starren Wänden.- 15.10.3.1 Erddruckversuche.- 15.10.3.2 Erdwiderstandversuche.- 15.10.3.3 Gleichzeitige Wirkung des Erdwiderstands und des Erddrucks.- 15.10.4 Einfluß der Biegsamkeit der Wände auf die Biegungsmomente.- 15.11 Schlußfolgerungen aus den Erddruck- und Erdwiderstandversuchen.- 16 Flachgründungen: Einzelfundamente und Plattengründungen.- 16.1 Allgemeines zur Berechnung der Gründungen.- 16.2 Flachgründungen (Einzelfundamente, Streifenfundamente, Plattengründungen) und Tiefgründungen (Pfähle, Brunnen, Pfeiler und Senkkästen).- 16.3 Besonderheiten der Flachgründungen.- 16.3.1 Einzelfundamente und Streifenfundamente.- 16.3.2 Plattengründungen.- 16.4 Berechnung der Grenzbodenpressung für Fundamente, die unmittelbar auf der Oberfläche des Bodens gegründet sind.- 16.4.1 Rolliger Boden.- 16.4.1.1 Annahme einer Neigung ? = 0 der Grenzbodenpressungen in der Kontaktfläche Fundament—Boden (Membranen).- 16.4.1.2 Annahme einer Neigung ? = - ? der Grenzbodenpressungen in der Kontaktfläche Fundament—Boden (Fundamente der Baupraxis).- 16.4.1.3 Einfluß eines keilförmigen Erdkörpers unterhalb der Gründung.- 16.4.1.4 Einfluß der dritten Dimension der Gründung.- 16.4.1.5 Experimentelle Überprüfung des Tragfähigkeitbei-werts s1.- 16.4.2 Bindiger Boden.- 16.4.2.1 Allgemeine Formel.- 16.4.2.2 Gesättigte Tone. Fall ? = 0.- 16.4.2.3 Einfluß der dritten Dimension der Gründung.- 16.4.2.4 Überprüfung der Theorie durch den Versuch.- 16.5 Berechnung der Grenzbodenpressung für nicht unmittelbar an der Oberfläche des Bodens gegründete Fundamente.- 16.5.1 Rolliger Boden.- 16.5.1.1 Ermittlung des Beitrags der Gründungstiefe zur Tragfähigkeit.- 16.5.1.2 Überprüfung der Theorie durch den Versuch.- 16.5.2 Bindiger Boden.- 16.6 Setzungsunterschiede von Plattengründungen, Einzel- und Streifenfundamenten.- 16.6.1 Wechselwirkung zwischen Aufstandfläche und Boden.- 16.6.2 Rolliger Boden unterhalb einer starren Gründung.- 16.6.3 Bindiger Boden unterhalb einer starren Gründung.- 16.6.4 Rolliger Boden unterhalb einer schlaffen Gründung (Membran).- 16.6.5 Bindiger Boden unterhalb einer schlaffen Gründung (Membran).- 16.6.6 Folgerungen für Plattengründungen, Einzel- und Streifenfundamente.- 16.7 Ermittlung der Gesamtsetzungen.- 16.7.1 Rollige Böden.- 16.7.2 Bindige Böden.- 16.7.3 Netto-Setzung nach Beendigung der Bauarbeiten — Netto-Endsetzung — Wahl von E.- 17 Tiefgründungen: Pfähle, Brunnen, Pfeiler, Senkkästen.- 17.1 Besonderheiten der Tiefgründungen.- 17.1.1 Pfähle.- 17.1.1.1 Rammpfähle.- 17.1.1.2 Bohrpfähle.- 17.1.2 Brunnen, Pfeiler, Senkkästen.- 17.1.3 Hydraulischer Grundbruch.- 17.1.3.1 Rolliger Boden.- 17.1.3.2 Bindiger Boden.- 17.2 Berechnung der Tragfähigkeit von Tiefgründungen.- 17.2.1 Allgemeine Betrachtungen.- 17.2.1.1 Rollige Böden.- 17.2.1.2 Bindige Böden.- 17.2.2 Versuchsergebnisse.- 17.2.2.1 Einsatz von Drucksonden in situ.- 17.2.2.2 Einsatz von Drucksonden im Laboratorium — Theorie aufgrund des Einsatzes.- 17.2.3 Tragfähigkeit von Tiefgründungen in rolligen Böden.- 17.2.3.1 Spitzenwiderstand.- 17.2.3.2 Seitliche Reibung.- 17.2.3.3 In Rechnung zu stellende seitliche Reibung.- 17.2.4 Tragfähigkeit von Tiefgründungen in bindigen Böden.- 17.2.4.1 Spitzenwiderstand.- 17.2.4.2 Seitliche Reibung.- 17.2.5 Spitzenwiderstand in einer Schicht begrenzter Dicke.- 17.3 Setzung eines Pfahls.- 17.4 Pfahlgruppen.- 17.4.1 Setzung einer Pfahlgruppe.- 17.4.2 Tragfähigkeit einer Pfahlgruppe.- 17.5 Knicken der Pfähle.- 17.6 Rammformeln.- 17.7 Anwendung auf die Erkundung der Bodenverhältnisse.- 17.7.1 Drucksondierungen.- 17.7.2 Vergleich der Ergebnisse aus Drucksondierungsversuchen mit denen aus Versuchen zum Bestimmen der Traglast von Pfählen.- 17.7.3 Rammsondierungen mit Probenentnahmestutzen.- 17.7.4 Rammsondierungen mit Eisenbahnschienen oder Versuchspfählen.- 18 Exzentrisch beanspruchte Gründungen.- 18.1 Allgemeines.- 18.2 Flachgründungen.- 18.2.1 Lösung mit Hilfe des Kerns des Querschnitts.- 18.2.2 Berücksichtigung der seitlichen Beanspruchung.- 18.2.3 Versuch einer Theorie.- 18.2.4 Praktische Folgerungen für Brückenwiderlager.- 18.3 Pfähle.- 18.3.1 Maximales Kippmoment eines Einzelpfahls.- 18.3.2 Pfahlgruppen.- 18.3.3 Durch Rammungenauigkeiten verursachtes Moment.- 19 Dünne, unbegrenzt ausgedehnte Platten, die auf dem Boden aufliegen und durch lotrechte Lasten beansprucht sind.- 19.1 Allgemeines.- 19.2 Schwierigkeiten der Untersuchung.- 19.3 Die beiden mathematischen Methoden.- 19.3.1 Methode Westergaard.- 19.3.1.1 Grundlagen der Methode Westergaard.- 19.3.1.2 Kritik zur Methode Westergaard.- 19.3.2 Methode Burmister.- 19.3.2.1 Grundlagen der Methode Burmister.- 19.3.2.2 Kritik zur Methode von Burmister.- 19.3.2.3 Versuche von Burmister.- 19.3.2.4 Versuche von Van der Veen.- 19.4 Schlußfolgerungen.- 20 Schächte, Tunnel, Silos.- 20.1 Zwei Grenzgleichgewichtszustände in der Umgebung eines Schachtes.- 20.2 Verteilung der Spannungen in der Umgebung eines Schachtes im Falle eines elastischen Gleichgewichtszustands.- 20.3 Tunnel.- 20.3.1 Elastisches Gleichgewicht.- 20.3.2 Plastisches Gleichgewicht für einen rolligen Boden.- 20.3.3 Plastisches Gleichgewicht für einen bindigen Boden.- 20.3.4 Anwendungen.- 20.3.4.1 In trockenem Sand angelegte Tunnel.- 20.3.4.2 In feuchtem Sand angelegte Tunnel.- 20.3.4.3 In Tonboden angelegte Tunnel.- 20.3.5 Gültigkeit des betrachteten plastischen Gleichgewichts.- 20.3.6 Überprüfung der Theorie durch den Versuch.- 20.3.7 Tunnel in Fels.- 20.3.8 Befestigung des Ausbruchquerschnitts der Tunnel.- 20.4 Silos.- 20.4.1 Unendlich ausgedehnte Silos.- 20.4.2 Rotationssymmetrische Silos.- 20.4.3 Polygonal begrenzte Silos.- 20.4.4 Schmale Rechtecksilos.- 20.4.5 Einfüllmechanismus.- 20.4.6 Mechanismus des Ausleerens.- 20.4.7 Zahlenrechnung.- 20.4.8 Beanspruchung des Trichters.- 21 Stabilität der Böschungen.- 21.1 Morphologie der Böschungsrutschungen.- 21.1.1 Rutschungen mit im allgemeinen kreisförmiger Gleitfläche.- 21.1.2 Rutschungen mit nicht ausgeprägter kreisförmiger Gleitfläche.- 21.2 Allgemeine Ursachen für Böschungsrutschungen.- 21.2.1 Veränderung des antreibenden Momentes durch Be- oder Entlastung am Böschungskopf oder -fuß.- 21.2.2 Veränderung des Wasserhaushalts.- 21.2.3 Große Rutschungsempfindlichkeit der Böden, gepaart mit einer großen Sensibilität.- 21.3 Maßnahmen zum Stoppen einer Böschungsrutschung.- 21.4 Grenzdicke einer geneigten bindigen Erdmasse.- 21.4.1 Berechnungsverfahren.- 21.5 Bedeutung der den Rutschungen vorausgehenden Verformungen.- 21.6 Berechnung des Grenzgleichgewichts einer Böschung.- 21.6.1 Heterogenes Gelände. Lamellenverfahren.- 21.6.2 Homogenes Gelände. Analytisches Verfahren.- 21.7 Ergebnisse von Böschungsuntersuchungen für einige einfache Fälle.- 21.8 Sicherheit gegenüber einer Böschungsrutschung.- Schrifttum.- Namenverzeichnis.
Date de parution : 01-1967
Date de parution : 02-2012
Ouvrage de 462 p.
15.5x23.5 cm
Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).
Prix indicatif 54,22 €
Ajouter au panierThème de Grundlagen der Bodenmechanik :
Mots-clés :
Beschaffung; Boden; Bodenmechanik; Deformation; Entwicklung; Geologie; Gestein; Kristallographie; Mineral; Mineralogie; Setzung
© 2024 LAVOISIER S.A.S.